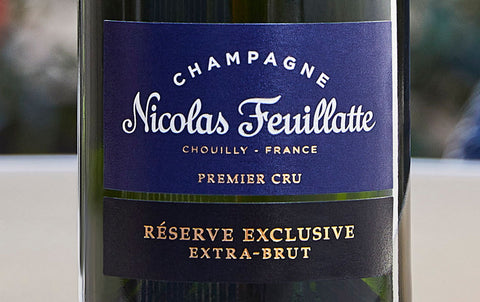Die Verkostung von Champagner ist eine Kunst, deren Beherrschung empfohlen wird, um seine feinen Bläschen voll und ganz zu genießen. Man muss kein Sommelier sein, um diese Gesten zu erlernen, die zu diesem Gaumenschmaus beitragen. Der Service, die Lagerung bei der richtigen Temperatur, die Verkostung... All das ist Teil desselben Ansatzes. Die Maison Nicolas Feuillatte berät Sie für ein in jeder Hinsicht gelungenes sensorisches Erlebnis.
Bei welcher Temperatur sollte man Champagner servieren?
Je nach dem gewählten Moment für die Verkostung schwankt die ideale Temperatur zwischen 7 und 12 Grad. Beim Aperitif bevorzugt man eine kühle Temperatur zwischen 7 und 8 Grad. Zum Essen kann man sich einen Service zwischen 10 und 12 Grad leisten. Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle für eine ideale Verkostung. Zu warm, verliert er an Leichtigkeit und Finesse, ein Unding für dieses prestigeträchtige Getränk.

Wie serviert man Champagner?
Der Service von Champagner ist Teil einer französischen Lebensart, ein Symbol, das fest im nationalen Kulturerbe verankert ist. Man serviert Champagner nicht wie man einen Bierkrug füllt. Zuerst hält man die Flasche am Boden, keinesfalls am Hals. Dieser Bereich, der als Hohlboden (oder von Profis als Piqûre) bezeichnet wird, ist sehr nützlich, wenn es darum geht, den kostbaren Schaumwein auszuschenken. Man fragt sich, wie der Daumen ohne ihn Halt finden könnte!
Zu beachten: Man gießt den Champagner sanft, mit einer langsamen und sicheren Bewegung. Am besten ist es, dies in mehreren Schritten zu tun, um einen unschönen Überschuss an Schaum zu vermeiden. Ideal ist es, das Glas nur zu 2/3 zu füllen, was das Risiko des Überlaufens begrenzt und eine perfekte Belüftung ermöglicht. Außerdem lässt man, außer bei Hochzeiten oder Geburtstagen (und selbst dann...), den Korken nicht „knallen“. Dieser Wein verdient Sanftheit und Raffinesse.
Bei einer 75-cl-Flasche fragt man sich manchmal, wie viele Gläser Champagner man seinen Gästen servieren kann: Wir haben hier einen speziellen Artikel dazu vorbereitet.
Falsche Vorstellung: Im Gegensatz zur weit verbreiteten Praxis sollte man weder eine Schale noch eine Flöte zum Servieren verwenden, sondern ein Weinglas. Viele Fachleute bevorzugen das Tulpenglas mit seiner ovalen Form, die sich nach oben verjüngt. Auf diese Weise entwickeln sich die Bläschen perfekt, ohne in einer Flöte zu eng zu sein oder in einer Schale mit ausgestelltem Rand zu sehr verstreut zu werden.
Bei Nicolas Feuillatte hat das önologische Komitee ein Dutzend Gläser getestet, bevor es sich für das Absolu-Glas entschieden hat!
Für weitere Informationen besuchen Sie den Artikel "In welchem Glas trinkt man Champagner".

Wie verkostet man Champagner?
Die Kunst der Champagnerverkostung beruht auf drei verschiedenen Phasen:
Die visuelle Prüfung
Man konzentriert sich auf die Robe und die Bläschen, die beiden Hauptelemente. Wie beim Rotwein charakterisiert die Robe die Farbe des Champagners, seine Reflexe und seine Farbtöne. Mit dem geschulten Auge eines Kenners kann man sogar die verwendete(n) Rebsorte(n), den Reifegrad oder die Gärmethode bestimmen.
So deutet eine blassgelbe Färbung auf einen eher jungen Champagner hin, der wahrscheinlich im Tank gereift ist. Im Gegensatz dazu ist ein kräftigeres Gelb ein deutliches Zeichen für einen im Fass gereiften Schaumwein. Was die Untersuchung der Bläschen betrifft, nichts einfacher als das: Man sucht nach feinen Bläschen, Symbolen für die Qualität der Produktion.
Die olfaktorische Analyse
Jetzt sind die Düfte und Aromen an der Reihe! Zuerst die „erste Nase“ durch tiefes Einatmen. Dann die „zweite Nase“ nach einigen kreisenden Bewegungen, die die Belüftung des Champagners fördern. Man sucht nach dem Reichtum und der Qualität des Bouquets, der Zusammensetzung der Gerüche, die jede Cuvée einzigartig machen. Man sagt, man „riecht“ den Champagner.
Die geschmackliche Untersuchung
Es ist Zeit, einen Schluck in den Mund zu nehmen, den man durch das Ansaugen eines Luftstroms auf den Schleimhäuten verteilt. Das Ziel? Die Qualitäten des Angriffs, des Abgangs und schließlich die Länge zu bestimmen. In diesem Stadium ist man in der Lage, den Säuregrad, den Körper und die Gesamtheit der Geschmacks- und Aromastoffe zu bestimmen.